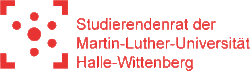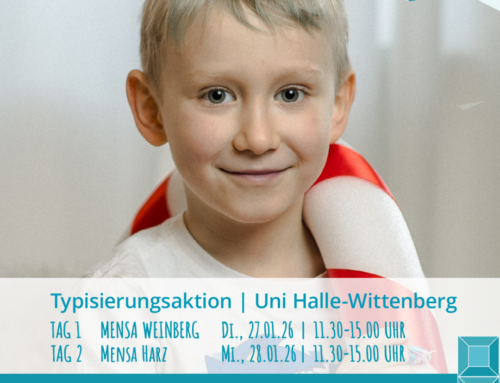Als Sprecher*innenkollegium des Studierendenrates der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg fördern und fordern wir die gleichberechtigte Diskussion zwischen Studierenden und ihren Dozierenden. Im Kontext der Einladung des israelischen Soziologie-Professors Moshe Zuckermann in das „Interdisziplinäre Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung“ (kurz: IZEA), haben verschiedene Akteur*innen scharfe Kritik geübt. Darunter sind auch Studierende des betroffenen Fachbereichs, die die inhaltliche Ausrichtung der inzwischen erfolgten Absage kritisieren. Dieser Kritik wollen wir als Sprecher*innenkollegium hier ein Forum bieten, damit sie auch ihre gleichberechtigte Berücksichtigung sowohl in der politischen als auch fachlichen Diskussion an der MLU erfährt:
Offener Brief an die Herren Professoren Fraisse, Dierken und Fulda sowie Frau Professorin Décultot bezüglich der von Ihnen veröffentlichten Stellungnahme vom 2. November 2020
Sehr geehrter Herr Prof. Fraisse,
sehr geehrter Herr Prof. Dierken,
sehr geehrter Herr Prof. Fulda,
sehr geehrte Frau Prof. Décultot,
im Rahmen der Vortragsreihe „Globaler Antisemitismus und die Dialektik der Aufklärung“ haben Sie für den 9. November 2020 den Soziologen Moshe Zuckermann eingeladen. In seinem Vortrag sollte er über „Anti-Semitismus-Vorwurf und Apologie des Kapitalismus: Zum Missbrauch der Dialektik der Aufklärung“ referieren. Nachdem sowohl die Einladung Moshe Zuckermanns als auch das geplante Vortragsthema öffentlich kritisiert worden waren, wurde der Vortrag abgesagt.
Auch wir Studierende haben in einem persönlichen Gespräch mit einem Veranstalter am 29. Oktober durch einen Vertreter sachliche Kritik an der Einladung Moshe Zuckermanns formuliert. Dabei haben wir unter anderem darauf hingewiesen, dass Moshe Zuckermann argumentativ immer wieder antisemitische Rhetoriken aufgreift. Wir haben betont, dass die Behauptung eines vermeintlichen Antisemitismusvorwurfs empirisch nicht haltbar ist und dem Referenten vielmehr zur Immunisierung seiner politischen Agenda dient. Wir haben unsere Befürchtung geäußert, dass im Rahmen der Vortragsreihe Ansichten verhandelt werden würden, die Versuchen, den Antisemitismus zu verstehen und zu erkennen, diametral entgegenstehen. Eine Ausladung des Referenten haben wir bewusst nicht gefordert. Ziel unserer internen Kritik war es vielmehr, unser Unverständnis über die Einladung zum Ausdruck zu bringen und für eine prinzipielle Kritik an Zuckermanns in der Vergangenheit geäußerten Aussagen zu sensibilisieren.
Dementsprechend bestürzt waren wir, als wir Ihrer anschließenden Stellungnahme entnahmen, dass Sie die Behauptung, mit dem Antisemitismusvorwurf werde pauschal gegen Kritiker der israelischen Regierungspolitik vorgegangen, nun selbst prominent und öffentlich in Dienst zu nehmen scheinen, um sie gegen Kritiker der Veranstaltung und damit auch gegen uns ins Feld zu führen. Ganz so als hätte die inhaltliche Problematisierung der Einladung Moshe Zuckermanns ein Sprechverbot erwirken sollen und keine sachliche Auseinandersetzung.
In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie:
Wir bedauern die Umstände, die den Referenten zur Absage des Online-Vortrags veranlasst haben. Dazu zählen öffentliche Unterstellungen gegenüber seiner Person und seinen Absichten. Ohne dass der Vortrag und die Differenzierungen des Referenten gehört werden konnten, wird behauptet, der Vortrag werde aufgrund früherer Kritik an der israelischen Regierungspolitik automatisch dem Antisemitismus Vorschub leisten. Wir weisen solche Unterstellungen zurück und halten fest, dass Moshe Zuckermann, ein Kind von Holocaust-Überlebenden, Jude und Bürger Israels, sich seit langem gegen Antisemitismus engagiert. Niemand ist befugt, ihm das Recht abzusprechen, sich zur israelischen Politik zu positionieren.
Damit reproduzieren Sie wortwörtlich die These Moshe Zuckermanns und übergehen unsere sachlich vorgetragene Kritik an der Einladung des Redners. Sie tun damit scheinbar genau das, wovor wir im Gespräch gewarnt haben: Indem der legitime Hinweis auf antisemitische Stereotypien pauschal als Antisemitismusvorwurf gekennzeichnet wird, kommt die inhaltliche Kritik an den Aussagen Zuckermanns nicht zu Wort. Stattdessen insinuieren Sie ein Sprechverbot, das von uns nie ausgesprochen wurde.
Dabei war und ist unsere Kritik nach wie vor legitim und gerechtfertigt. Die Behauptung eines Sprechverbots, das sich über den Antisemitismusvorwurf begründet, entbehrt der empirischen Grundlage. Der Argumentationsfigur wird in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus vielmehr selbst eine Nähe zum antisemitischen Denken attestiert.1 Die Berliner Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel hat dahingehend festgestellt: „Die kommunikative Leugnung und semantische Umdeutung des eigenen VerbalAntisemitismus gehört heute standardmäßig zu den Strategien moderner Antisemiten.“2 Der Politologe Samuel Salzborn weist zudem darauf hin, dass sich im Vorwurf des Antisemitismusvorwurfs der Sachverhalt gefährlich umkehre: „Nicht die Antisemit(inn)en werden kritisiert, sondern ihre Kritiker(innen).“3 Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin warnt dementsprechend schon länger vor dieser politisch immer wieder in Anspruch genommenen Immunisierungsstrategie. Er stellt klar: „Antisemitismus ist nicht, wie […] oft insistiert wird, ein (ungerechtfertigter) ‚Vorwurf‘, sondern wenn Äußerungen zu Israel als antisemitisch klassifiziert werden, dann handelt es sich dabei in der Regel um eine Kritik an antisemitischen Positionen. Wer diese entkräften will, müsste also argumentieren, warum die eigene Position nicht antisemitisch ist – und nicht Kritik zum ‚Vorwurf‘ verniedlichen und damit relativieren.“4
Zahleiche wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Kräfte haben in den letzten Jahren auf Zuckermanns Nähe zu antisemitischen Akteuren und Argumentationsmustern hingewiesen. Darunter etwa die Frankfurter Jüdische Gemeinde, der Zentralrat der Juden in Deutschland, das American Jewish Committee, Makkabi Deutschland, der Politiker Volker Beck, die Publizistin Jutta Ditfurth und der Frankfurter Bürgermeister der CDU, Uwe Becker, im Rahmen einer Konferenz in Frankfurt.5 Aber auch der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), die Liberale Hochschulgruppe und die Grüne Hochschulgruppe der Uni Duisburg-Essen sowie das Junge Forum der DIG Ruhr angesichts einer Veranstaltung in Essen.6 Auch Tom Uhlig, Bildungsreferent der Bildungsstätte Anne Frank, reagierte im Dezember 2019 auf Äußerungen Zuckermanns gegenüber der Zeitung Neues Deutschland, in denen dieser gegen die Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) polemisierte.7
Mit Ihrer Stellungnahme scheinen Sie von den inhaltlich fundierten und vor allem legitimen Bedenken, auf die sich auch unsere Kritik stützt, absehen zu wollen. Dabei stützen wir uns in unseren Einwänden gerade auf die Expertise derjenigen, die sich in Wissenschaft und Gesellschaft für allgemeine Standards in der Antisemitismusforschung- und bekämpfung einsetzen. Antisemitismusforscherinnen und -forscher, aber auch deutsche Jüdinnen und Juden warnen seit Jahren vor Diskursstrategien, die darauf ausgelegt sind, den Antisemitismus in Deutschland zu verharmlosen. Wir vermissen angesichts dessen die Auseinandersetzung mit dieser und unserer Kritik an den Äußerungen Moshe Zuckermanns.
Die in Aussicht gestellte Diskussionsrunde, die den Vortrag von Herrn Zuckermann nun ersetzen soll, erscheint uns aus oben genannten Gründen nachhaltig belastet zu sein. Wir sind uns unsicher, inwiefern eine gleichberechtigte und offene Diskussion der Positionen Zuckermanns nach der scharfen Positionierung, die Sie in Ihrer Stellungnahme formuliert haben, noch möglich ist.
Gezeichnet
Einige Studierende des Masterstudiengangs „Kulturen der Aufklärung“
1 Anknüpfungspunkte bestehen insbesondere zu Elementen des linken und rechten Schuldabwehrantisemitismus und des israelbezogenen Antisemitismus, siehe exemplarisch: Monika Schwarz-Friesel/Jehuda Reinharz: Europäisch-jüdische Studien Beiträge. Band 7: Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Herausgegeben vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien, Potsdam, in Kooperation mit dem Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Berlin/Boston, https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/262065/zur-verbreitung-des-antisemitismus-in-deutschland.
2 https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/211516/aktueller-antisemitismus.
3 https://www.bpb.de/apuz/311621/sprechen-und-schweigen-ueber-antisemitismus.
4 http://www.salzborn.de/txt/2013_Kirche-und-Israel.pdf.
5 https://www.juedische-allgemeine.de/gemeinden/pro-israel-und-contra-hass/, https://www.juedische-allgemeine.de/politik/kundgebunggegen-antisemitismus-und-israel-hass/, https://taz.de/Umstrittene-Konferenz-in-Frankfurt/!5415933/.
6 https://www.waz.de/staedte/essen/uni-duisburg-essen-asta-zerbricht-an-antisemitismus-streit-id211326097.html, https://jungle.world/artikel/2017/30/zoff-der-uni.
7 https://www.belltower.news/israelkritik-wenn-antisemitismus-ploetzlich-kein-antisemitismus-mehr-sein-soll-93651/.