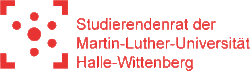Nach dem Urteil: Zeit für Selbstreflexion in Wittenberg
Die Wittenberger Stadtkirchengemeinde hat am 6.2. vor Gericht gesiegt. In der letzten Woche hat das OLG Naumburg entschieden, dass die als Schmähplastik bekannte „Wittenberger Judensau“ nicht entfernt werden muss. Geklagt hatte ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde. Das Urteil wurde u.a. damit begründet, dass in der Nähe der antisemitischen Schmähplastik bereits eine Gedenktafel angebracht worden wäre.
Was hier rechtlich ausgefochten wurde, ist aber eigentlich ein politisches Problem: Wie geht man mit judenfeindlichen Zeugnissen um, die in diesem Fall aus dem Mittelalter kommen, aber auch bei der Entwicklung des modernen Antisemitismus eine beträchtliche Rolle gespielt haben? Wie geht man mit denjenigen um, die sich davon völlig zu Recht beleidigt fühlen?
Als Studierendenrat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg glauben wir nicht, dass es mit einer Gedenktafel am Boden gegenüber der Plastik an der Wand getan sein kann. Die Schmähplastik ist kein harmloses und unbelebtes Stück Geschichte, sondern knüpft an heute noch aktuelle antisemitische Ressentiments an. Sie steht für die Entmenschlichung von und für wahnhafte Projektion auf Jüdinnen und Juden. Insbesondere in der „Lutherstadt Wittenberg“, deren Namensgeber immens an der Popularisierung antisemitischer Hetze in der frühen Neuzeit mitgewirkt hat, sollte man antisemitische Darstellungen nicht per Gerichtsbeschluss verteidigen.
Vielmehr fordern wir die Kirche dazu auf, jetzt die eigene Position zu reflektieren und sich zu fragen, was man da verteidigt. Es braucht offensichtlich ein neues Konzept, um mit der „Judensau“ sinnvoll umzugehen und sie tatsächlich kritisch und als das zu behandeln was sie ist: antisemitische Hetze.