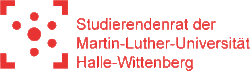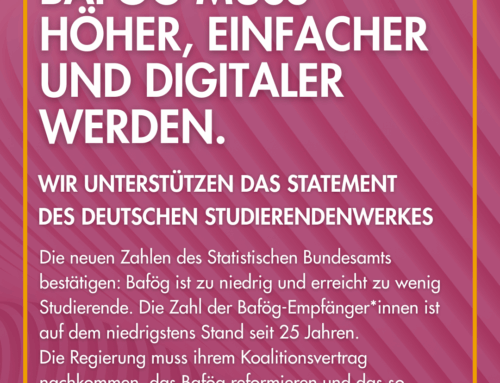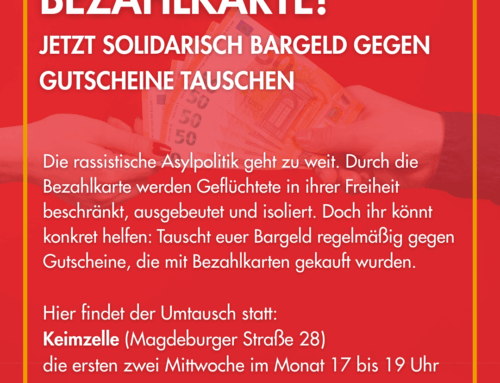An den deutschen Universitäten in der Weimarer Republik und auch im vorherigen Kaiserreich waren anti-demokratische, antisemitische und sexistische Positionen oftmals verbreiteter als in der gesamten Gesellschaft. Während man sich faschistische Ideologie gegenwärtig oftmals aus dem Mangel an formaler Bildung und akademischer Qualifikation herzuleiten versucht, war es eigentlich genau umgekehrt: Die Studierenden waren in weiten Teilen nicht progressiv, sondern zutiefst reaktionär. Mehrheitlich lehnten sie früh die Demokratie ab und sprachen sich für eine völkische Hochschulpolitik aus, die Jüdinnen und Juden sowie Frauen den Zutritt zu den Hochschulen (wieder) verweigern sollte. Vorboten dieser Haltung, die im Verlauf der Geschichte der Weimarer Republik immer hegemonialer werden sollte, finden sich bereits in der Studenten- und Professorenschaft des wilhelminischen Kaiserreichs.
Als 1879 der Begriff „Antisemitismus“ durch den Journalisten Wilhelm Marr als positive Selbstbezeichnung erstmals geprägt wurde, sprangen Professoren auf. 1880 startete eine völkische Gruppe die „Antisemitenpetition“, die die Rechtsgleichheit von Jüdinnen und Juden aufheben sollte. Besondere Prominenz erhielt diese Petition durch das Wirken des renommierten Geschichtsprofessors Heinrich von Treitschke, der den Satz „Die Juden sind unser Unglück“ geprägt hat und dessen Studenten die „Antisemitenpetition“ unterschrieben und verbreiteten. Diese Verbreitung war darüber hinaus Grundlage für die Gründung den „Verband der Vereine deutscher Studenten“ (VVDSt), der sich wie andere Studentenverbindungen im Kaiserreich oder später in der Republik für ein monarchistisches und völkisches Leben an den Hochschulen einsetzte und bei sich selbst – noch bevor es die NSDAP überhaupt gab – einen „Arierparagraphen“ zur Ausgrenzung jüdischer Studenten beschlossen hatte. Diese Haltung sollte sich in der Studentenschaft ausbreiten und festigen.
Deshalb zogen 1914, zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, auch tausende Studenten begeistert in den nationalistisch motivierten Krieg. Davon zeugt noch heute eine Statue auf dem Steintor-Campus in Halle (Saale), die mit nationalistischer Symbolik vorgeblich um die Gefallenen des deutsch-französischen Kriegs von 1870/71 und des Ersten Weltkriegs trauert, diese aber gleichzeitig aufgrund ihres militärischen Einsatzes als heroisch verklärt. Die Jahre 1918 und 1919 wurden von einigen studentischen Kriegsheimkehrer als Schock erlebt: Niederlage, Revolution und Demokratie wurden als volksfeindlich, chaotisch und zerstörerisch gebrandmarkt, weshalb sich viele Mitglieder von Studentenverbindungen den rechtsradikalen Freikorps-Truppen anschlossen, die demokratische und sozialistische Bestrebungen in der post-revolutionären Situation der frühen Weimarer Republik mit tödlicher Gewalt bekämpften. In Halle wurde im Zuge dieser Gewalt im März 1919 beispielsweise der linke Aktivist Karl Meseberg ermordet, der sich im Arbeiter- und Soldatenrat der Stadt engagierte.
Es gab aber auch Studierende, die sich demokratisch engagierten, den Sturz der Monarchie und das Ende des Krieges begrüßten. Nach dem Ende des Krieges bildete sich eine Vielzahl nicht-reaktionärer sozialdemokratischer, (links)liberaler, kommunistischer oder katholisch-demokratischer Hochschulgruppen heraus, die (auch) in der „Deutschen Studentenschaft“ (DSt) vertreten waren. Diese wurde 1919 als Zusammenschluss der „Allgemeinen Studentenausschüsse“ gegründet und ist somit eine Art Vorläuferin der verfassten Studierendenschaften, die heute durch lokale Studierendenräte oder „Allgemeine Studierendenausschüsse“ (AStA) geprägt sind. In dieser waren sowohl teilweise liberale „Freistudentenschaften“ vertreten als auch progressive oder schwer zuzuordnende Gruppen. 1920 organisierte sich allerdings bereits die völkische Machtübernahme mit dem „Deutschen Hochschulring“ (DHR, auch: Hochschulring deutscher Art / HdA), der bald nicht nur von den meisten Studentenverbindungen, sondern auch von der der überwältigenden Mehrheit der ehemaligen Freistudentenschaften und der „unpolitisch“ organisierten Studentengruppen unterstützt wurde. Ab 1923 stand die DSt dann unter völkisch-nationaler Kontrolle, die das Ziel einer „Schaffung einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft“ verfolgte. Als demokratischer Akteur fiel die gewählte Repräsentation der Studierenden ab diesem Zeitpunkt also völlig aus. Die Studierenden hatten die Wahl, aber entschieden sich für Hochschulen ohne Jüdinnen und Juden, Frauen und demokratische Positionen. Die DSt machte den Antisemitismus salonfähig, gab ihm einen akademischen Anstrich und ließ Dozenten verfolgen – wie den Hannoveraner Philosophiedozenten Theodor Lessing – , die es wagten andere Positionen einzunehmen. 1927 sah sich die demokratische Regierung des Landes Preußens gezwungen die Studentenschaft in dem Gebiet aufzulösen, weil die Auswahl der Mitgliedschaft nach „rassischen“ Kriterien erfolgen sollte.
In dieses ideologische Milieu trat dann der 1926 gegründete „Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund“ (NSDStB), um den universitären Boden für die NS-Machtübernahme vorzubereiten. Er hatte zuerst geringen Erfolg, weil die rechtsextreme Mehrheit zwar Kontakt zur NSDAP und zu Adolf Hitler gesucht hatte, aber die NS-Studenten aufgrund ihres korporierten Elitarismus als „Pöbel“ verachteten. Mit dem Aufstieg der NSDAP zur größten Partei passierte aber das, was auch mit den anderen völkischen Parteien im Parlament passieren musste: Der NSDStB gewann die Wahlen dort, wo ihre Positionen schon vorher größtenteils akzeptiert und verbreitet wurden. 1931 wurde ein Nationalsozialist Vorsitzender der DSt, 1932 wurde das Führerprinzip eingeführt. Oppositionelle Positionen wurden ausgeschaltet, die Gleichschaltung der Vertretung der deutschen Studierenden wurde noch vor der Errichtung der NS-Diktatur am 30. Januar 1933 vollzogen. 1926 nannten die gegen Theodor Lessing hetzenden Völkischen ihre Tat bereits „Aktion wider den undeutschen Geist“. Die Bücherverbrennungen im Mai 1933 wurden von den Nazis unter dasselbe Motto gestellt und im April 1933 verkündete die DSt bereits: „Der Staat ist erobert. Die Hochschule noch nicht! Die geistige SA rückt ein. Die Fahne hoch!“
Die Folgen waren klar: Die Studenten denunzierten und verfolgten alle, die sich nicht dem NS unterwerfen wollten oder konnten, weil sie jüdisch waren oder als antifaschistisch galten. Für viele Menschen war die Verbrennung ihrer Bücher im Nachhinein ein Vorzeichen für den Massenmord in den Konzentrations- und Vernichtungslagern.
Auch die Vertreter des DHR, die die DSt vorher auf die faschistische Spur gebracht hatten, wurden nun zur Gleichschaltung gezwungen und etliche Studentenverbindungen bekundeten ihre Treue zum Nationalsozialismus. Der Kösener Senioren-Convent erklärte 1933 beispielhaft: „Das deutsche Corpsstudententum hat in einer einmütigen Kundgebung den Willen dargetan, sich ohne jeden Vorbehalt einzugliedern in die nationalsozialistische Bewegung“. Für die völkischen Studenten endete mit dem Jahr 1933 die selbstständige politische Betätigung. Trotzdem standen sie der NS-Politik wie der Bücherverbrennung positiv gegenüber, stand die DSt doch vorher schon für Antisemitismus, Nationalismus, Sexismus, Rassismus und gegen jede Demokratie.
Verweise:
Tobias Eisch: „Elitär-barbarische Avantgarde – Die deutsche Studentenschaft und der Weg in den Faschismus“.
Hans-Walter Schmuhl: „Halle in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“.